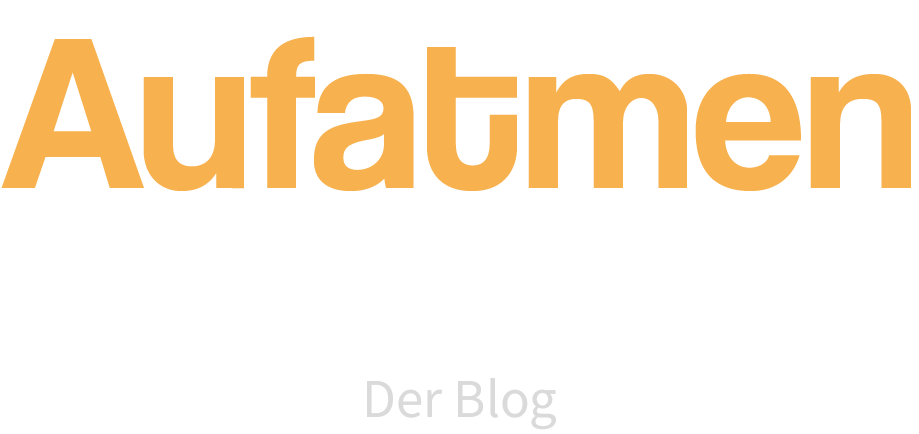Diesen Artikel wollte ich ursprünglich gar nicht schreiben. Denn persönlich bin ich der Meinung: Christen sollten sich sammeln um Jesus, Bibel und Bekenntnis. In politischen Fragen werden sie niemals einer Meinung sein. Stattdessen sollten sie ein Vorbild darin sein, auch bei großen Meinungsdifferenzen respektvoll miteinander im Gespräch zu bleiben.
Thorsten Dietz ist aber der Meinung, dass das Thema Rechtspopulismus unbedingt ganz oben auf die Tagesordnung der Evangelikalen gehört: „Ich sehe in der rechtspopulistischen Versuchung die größte Gefahr der Evangelikalen in der Gegenwart.“ (S. 301) Hinter dieser Überzeugung steht ein Ereignis, dass aus der Sicht von Thorsten Dietz „ein weltgeschichtlicher Einschnitt“ (S. 278) war: „Die Ära Trump ist eine Zäsur. Denn durch die rückhaltlose Unterstützung seiner Präsidentschaft durch die überwältigende Mehrheit der Evangelikalen wurde die öffentliche Wahrnehmung des Evangelikalismus für die Gegenwart neu justiert. Evangelikale werden in der amerikanischen Öffentlichkeit weit überwiegend durch ihre politische Einstellung definiert. Für die besten Kenner ihrer Geschichte ist die Marke »evangelikal« dadurch mindestens beschädigt.“ (S. 51)
Während es im vorherigen Artikel um den Rückzug der Evangelikalen aus der Gesellschaft ging, steht hier der gegenteilige Vorwurf im Raum: Evangelikale wollen zur politischen Macht greifen und damit ihre rechten Positionen durchboxen. Auch in Deutschland sieht Dietz eine „christliche Rechte“. Dietz zitiert den evangelischen Theologen Martin Fritz, der deren Positionen wie folgt beschreibt:
„Die Moderne wird als Auflösung von moralischen und gesellschaftlichen Verbindlichkeiten begriffen. Angesichts dieser Auflösungstendenzen wird die Notwendigkeit eindeutiger Normen gefordert. … Linke Politik wird als Gängelung empfunden. Die Wahrung der eigenen Grundrechte wird stark betont. Der gesellschaftliche Kulturwandel wird im weitesten Sinne als kulturmarxistisch empfunden. Die Geschichte Osteuropas ist sehr präsent. »Nie wieder Sozialismus« ist eine weitverbreitete Überzeugung. …. Verwurzelung in der Heimat ist wichtig. … Insbesondere der Islam ist ständiger Gegenstand prinzipieller Abgrenzung. Der Islam gilt als demokratieunfähig. … Die Auflösung klassischer Geschlechterrollen gilt als große Gefahr. Vor allem die mögliche Verwirrung der eigenen Kinder in der Schule wird gefürchtet. … Rechts ist für Fritz ein klassisch-konservatives Christentum im Modus des Kulturkampfes. Zur rechten Ideologie gehört der Kampfcharakter, der Verzicht auf das Ziel, gemeinsam mit allen und für alle Gesellschaft zu gestalten.“ (S. 297/298) Und Dietz ergänzt: „Mit ihren Idealen und ihren Bündnisgenossen ist die christliche Rechte im Kern antidemokratisch.“ (S. 304) Dadurch unterscheiden sie sich fundamental von „Konservativen“, denn sie „zeichnen sich eher durch hohe Grundwerte in Fragen wie Staatsvertrauen und Fortschrittszuversicht aus.“ (S. 299)
Was können wir von Thorsten Dietz lernen?
Die Versuchung der Kirche, sich mit der politischen Macht zu verbünden, ist uralt. Seit der „konstantinischen Wende“ im vierten Jahrhundert zieht sich dieses Problem durch die europäische Kirchengeschichte. Er hat dem Evangelium immer wieder enorm geschadet. Thorsten Dietz empfiehlt m.E. zurecht, sich davon abzuwenden. Nicht erwähnt wird leider, dass das natürlich vor allem für die Volkskirchen dramatische Konsequenzen hätte!
Natürlich sollen sich Christen als demokratische Bürger positiv in den Staat einbringen und ihn nach Kräften mitgestalten. Der Versuchung, spezifisch christliche Positionen nicht über den Weg der Verkündigung, sondern durch Machtmittel durchsetzen zu wollen, sollte die Christenheit aber strikt widerstehen. Wir sehen gerade wieder in Russland, in welch furchtbaren (und berechtigten!) Misskredit das die Kirche bringt. Die Kirche Jesu ist immer gebunden an das Wort Jesu: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ (Joh. 18, 36) Wir sollten alles, was in unserer Macht steht, dazu beitragen, dass „evangelikal“ auch zukünftig für leidenschaftliche Jesusnachfolger steht – und nicht für ein spezielles politisches Milieu.
Dafür sollten wir auch die Mahnung von Markus Spieker beachten: „Jesus-Nachfolge und Wut-Rhetorik passen nicht zusammen.“[1] Wenn wir als Christen unsere politische Meinung einbringen, dann sollten wir nicht nur durch inhaltlich fundierte, durchdachte Äußerungen auffallen, sondern zugleich auch durch unseren respektvollen Tonfall. Wenn sich die Gesellschaft zunehmend nur noch anschreit, dann sollten wir vorleben, wie eine gute, demokratische Debattenkultur aussehen kann.
Gibt es Anfragen oder Gegenperspektiven zu den Thesen von Thorsten Dietz?
Beim Lesen der Zitate von Martin Fritz habe ich mich gefragt: Gehöre ich denn auch zur „christlichen Rechten“? Tatsächlich muss ich „gestehen“: Die Wahrung der Grundrechte ist mir sehr wichtig. Ich finde: Die Geschichte Osteuropas sollte uns allen sehr präsent sein. Und ist denn der Satz »Nie wieder Sozialismus« angesichts der furchtbaren Entwicklungen in Venezuela, in den sozialistischen Regimen im ehemaligen „Ostblock“ und angesichts der grauenvollen Blutspur in den kommunistischen Diktaturen des 20. Jahrhunderts eine anrüchige Position? Gibt es nicht gute Gründe, Heimatverwurzelung für eine wertvolle Grundlage für eine gesunde Identifikation mit unserem Gemeinwesen zu halten? Gibt es im weltweiten und im historischen Islam nicht wirklich Anzeichen für antidemokratische (und antisemitische!) Tendenzen, auf die auch liberale Muslime mahnend hinweisen? Und ja, ich gebe zu: Meine Fortschrittszuversicht ist begrenzt. Gegen einen schamgrenzenüberschreitenden Sexualkundeunterricht bin auch ich schon demonstrieren gegangen. Und bestimmte Konkretionen linker Politik, wie zum Beispiel die „Gendersprache“, empfinde ich nicht nur aus sachlichen Gründen als Irrweg sondern tatsächlich als Gängelung. Laut Umfragen scheint es einem großen Teil der Bevölkerung ähnlich zu gehen.
Natürlich ist es wichtig, nicht auf üble politische Vereinfacher hereinzufallen. Aber trägt die Verknüpfung solcher Meinungen mit Adjektiven wie „antidemokratisch“ nicht nur weiter zur Spaltung der Gesellschaft und zur Vergiftung der notwendigen Diskurse bei? Muss man nicht auch diese Positionen ernst nehmen und einbeziehen, wenn man „gemeinsam mit allen und für alle Gesellschaft … gestalten“ möchte? Und wäre es umgekehrt nicht gerade wichtig, dass sich die intellektuellen Eliten einmal selbstkritisch dem Vorwurf der „Gängelung“ stellen, statt vorschnell die „rechte Keule“ zu schwingen?
In seinem Buch „Übermorgenland“ stellt Markus Spieker die These auf: „Heute sind es der Duktus, der Jargon, die Attitüde der »politisch korrekten Avantgarde«, die bodenständigen Gemütern die Galle überlaufen lassen. Aus diesem Frust speit sich der Erfolg populistischer Politiker, die ihn zum neuen Klassenkampf stilisieren.“ (S. 162) Tatsächlich wird mittlerweile in breiten gesellschaftlichen Kreisen diskutiert, dass die „Woke-Culture“ mit ihrem gruppenbezogenen identitätspolitischen Ansatz einen aggressiven Kulturkampf führt, der stark zur wachsenden Polarisierung beiträgt (siehe z.B. der vielbeachtete Text von Wolfgang Thierse oder der Bericht der ehemaligen New-York-Times Journalistin Bari Weiss).
Carl Trueman ist in seinem Artikel „über das Versagen der evangelikalen Eliten“ der Meinung, dass diese Dynamik auch bei der Wahl von Donald Trump eine viel zu wenig beachtete Rolle spielte. In dem Bemühen, die Verächter des Christentums zu besänftigen, war es laut Trueman für viele evangelikale Leiter „nur zu einfach, das simplifizierte progressive Narrativ zu übernehmen: Jeder einzelne Trump-Wähler ist ein ignoranter Fanatiker und, wenn er sich zum Christentum bekennt, auch ein Heuchler. Der Gedanke, dass nicht alle, die für Trump gestimmt haben, dies mit Begeisterung taten, hatte keinen Platz in der Interpretation der säkularen Elite von 2016; und er passte auch nicht in das therapeutische Narrativ, das von vielen Anti-Trump-Christen übernommen wurde. … Zuzugeben, dass Trumps Sieg kein Produkt des weißen christlichen Nationalismus oder eines ähnlich simplen Konstrukts war, hätte ein schmerzhaftes Maß an Gewissensprüfung und Selbstkritik seitens der leitenden Schichten der Gesellschaft im Allgemeinen und des Christentums im Besonderen erfordert. Und das machte die beiden extremen Lager, Trump und Anti-Trump, ähnlich in ihrer moralischen Klarheit, mit der jedes glaubte, seine Gegner zu verstehen.“
Bei aller notwendigen evangelikalen Selbstkritik in Bezug auf die Vorgänge rund um Donald Trump: Die Versuchung ist offenbar auf allen Seiten groß, weniger vor der eigenen Haustüre zu kehren, sondern lieber empört auf Andere zu zeigen. Erfreulicherweise räumt Thorsten Dietz an anderer Stelle im Buch ein, dass Donald Trump auch für viele weiße Evangelikale durchaus kein Traumkandidat war, sondern schlicht das kleinere Übel. Noch schöner wäre es gewesen, wenn er erwähnt hätte, dass es durchaus auch populäre weiße Evangelikale gab (wie z.B. John Piper), die sich öffentlich von Trump distanziert haben.
Bleibt noch die Frage: Ist (politische) Polarisierung wirklich vornehmlich ein Problem der Evangelikalen? Der US-Amerikaner Trevin Wax berichtet von einem Forschungsprojekt, das auf Basis zahlreicher Recherchen und Interviews zu dem Schluss kommt: Es sind eher die „progressiven“ Christen, die ihre Identität über Politik definieren, während konservative Christen ihre Identität eher in der Theologie finden. Progressive Christen sind deshalb auch weniger als konservative Christen dazu bereit, über abweichende politische Auffassungen hinwegzusehen. Zudem berichtet Wax: „Die allgemeine Auffassung ist, dass theologisch konservative Christen in einer Blase von Gleichgesinnten verharren. Aber die Untersuchungen von Yancey und Quosigk haben das Gegenteil gezeigt. Es sind theologisch progressive Christen, die sich mit homogen denkenden Gleichgesinnten umgeben, und ein Teil dieser Homogenität definiert sich durch eine »überwältigend negative« Sicht auf konservative Christen. … In der Tat ist die progressive Sicht der Konservativen so düster, dass sich Progressive eher mit Muslimen als mit konservativen Christen verbunden fühlen.“ Das hat Konsequenzen für die Frage, was progressive Christen unter Mission verstehen: „Die meisten progressiven Christen … haben … nicht das Bedürfnis, andere zu ermutigen, … den christlichen Glauben anzunehmen. Der Kern ihrer Religion beruht auf den Werten der Integration, der Toleranz und der sozialen Gerechtigkeit. … Die Menschen, die am meisten der “Bekehrung” bedürfen, sind deshalb nicht Ungläubige, sondern konservative Christen.“
Diese Ergebnisse mögen für Manche überraschend klingen. Inwieweit sie auf Deutschland übertragbar sind, habe ich an anderer Stelle diskutiert. In diesem Artikel will ich am Ende vor allem Mut machen zu dem, was ich eingangs schon betont habe: In politischen Fragen sollten Christen Vorbild darin sein, sich von vereinfachender Wutrhetorik fernzuhalten, Meinungsdifferenzen auszuhalten und respektvoll im Gespräch zu bleiben. Unser gemeinsamer, verbindender Fokus sollte immer das biblisch bezeugte Evangelium von Jesus Christus sein. Meine Wahrnehmung ist, dass das unter konservativen Christen nicht schlechter gelingt als unter „Progressiven“ oder „Liberalen“.
Worüber sollten wir uns dringend gemeinsam klar werden?
Wollen wir uns von politischen Vereinfachern und düsterer, verächtlichmachender Kampfrhetorik distanzieren, uns zugleich aber trotz politischer Differenzen um Jesus und um das Evangelium sammeln und die gemeinsame Verbreitung des Evangeliums in den Vordergrund stellen?
—————————————————————————-
[1] Markus Spieker: Übermorgenland, Fontis Verlag 2019, S. 113
Weiterführend:
- Ist Einheit zwischen progressiven und konservativen Christen möglich? – Erkenntnisse aus einem Forschungsprojekt
- “Warum die Woke-Culture die Evangelikalen spaltet“: Auszüge aus der brillanten Zeitanalayse von Prof. Carl R. Trueman, ins deutsche übersetzt und kommentiert von Markus Till
⇒ Weiter geht’s mit Frage 8: Fremdeln die Evangelikalen mit ihrem sozialen Auftrag?
⇒ Hier geht’s zur Übersicht über die gesamte Artikelserie.