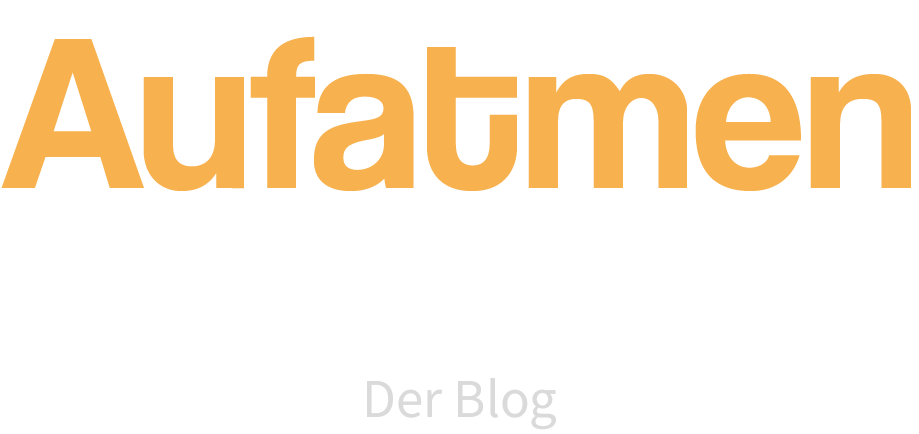Gedanken zu einem AUFATMEN-Gespräch zwischen Thorsten Dietz und Stephanus Schäl
Wie gelingt Einheit in Vielfalt? Das ist zweifellos eine Schlüsselfrage für die evangelikale Bewegung in Deutschland. In einer Serie von Artikeln haben Thorsten Dietz und Stephanus Schäl über diese Frage gesprochen.[1] Beide sind einflussreich im allianzevangelikalen Umfeld.[2] In welche Richtung denken sie? Kann man manches auch anders sehen? Gibt es fehlende Aspekte? Ein Beitrag zu einer Diskussion, die dringender denn je geführt werden muss.
Warum tun wir uns so schwer mit der Einheit, für die Jesus doch so intensiv gebetet hat? Zurecht weisen Schäl und Dietz darauf hin: Es sind allzuoft ganz menschliche Abgründe, die unsere Einheit untergraben. Wenn Machtstreben sich verbindet mit der Unfähigkeit, zwischen biblischer Aussage und eigener Bibelauslegung zu unterscheiden, dann kann Einheit nicht gelingen. Zudem betonen beide: Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus sei Einheit ja schon Realität. Wir gehören zur gleichen Familie, egal ob wir uns lieben oder streiten. Deshalb sollten wir doch miteinander statt übereinander reden, Vorurteile und „Lagerdenken“ vermeiden, vom Kampf- in den Dialogmodus wechseln und stets die Begrenztheit der eigenen Perspektive im Blick behalten. Wenig hilfreich sei es, zwischen „innen” und „außen” bzw. zwischen „uns” und „ihnen” zu unterscheiden. Wir sollten Einheit nicht zerreden, sondern sie lieber erfahrbar werden lassen im Einsatz für gemeinsame Ziele und die gemeinsame Sendung der Kirche.
Ein fehlender Aspekt: Zurückweisung von falscher Lehre
All das lässt sich biblisch gut begründen. Allerdings findet man im Neuen Testament einen weiteren Aspekt zum Thema Einheit, der in der Artikelserie fehlt: Die notwendige Zurückweisung falscher Lehre. In den 7 Sendschreiben der Offenbarung nimmt dieses Thema sogar den größten Raum ein. Einige Briefe im NT (insbesondere der Judasbrief) sind regelrechte Streitschriften gegen falsche Lehre. Das „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat“ (Römer 15, 7) steht im Neuen Testament durchgängig auf dem Fundament der apostolischen Lehre als einer verbindlichen gemeinsamen Grundlage:
„Ich bitte euch aber, Brüder, nehmt euch vor denen in Acht, die von der Lehre abweichen, wie ihr sie gelernt habt! Sie rufen nur Spaltungen hervor und bringen den Glauben der Geschwister in Gefahr. Geht ihnen aus dem Weg!“ (Römer 16, 17)
Falsche Lehre wird von Paulus also ausdrücklich als Spaltungsursache benannt. Auch deshalb findet er so harte Worte, wenn am Evangelium etwas verändert wird (Galater 1, 8+9). Und er scheut sich nicht, für die Verteidigung des Evangeliums auch übereinander zu reden (zum Beispiel über die Verfehlungen von Petrus in Galater 2, 11-14).
Biblische Offenbarung als Basis für starke Mitte?
Schäl schreibt deshalb zurecht:
„Christliche Einheit braucht … das Festhalten an der biblischen Offenbarung als zuverlässige Richtlinie für Lehre und Leben. Wo die Bibel nicht mehr norma normans, also normierende Norm für Glauben, Theologie und Ethik ist, verkommt die Einheit zur Beliebigkeit.“
Und Thorsten Dietz ergänzt: „Eine starke Mitte kann sehr, sehr viel Buntes und Verschiedenes aushalten.“ Die Frage ist nur: Wie soll die verbindende starke Mitte definiert und der Inhalt der „normierenden Norm“ festgestellt werden, wenn wir zwar „Festhalten an der Wahrheit der Bibel“, aber zugleich wissen, „dass unsere eigene Perspektive auf diese Wahrheit begrenzt, stückhaft und unvollständig ist“ (Stephanus Schäl)?
Schäl schlägt einen Minimalkonsens vor: „Wir gruppieren uns um Christus, so wie er uns in der Bibel beschrieben wird. Und: Ich glaube, Einheit ist wirklich nicht möglich, wenn wir in Zweifel ziehen, dass die Offenbarung Gottes Grundlage für unser ganzes Denken ist.“ Reicht der so formulierte Bezug auf Christus, Bibel und Offenbarung, um zu gemeinsamen, verbindenden Kernüberzeugungen zu gelangen?
Vertrauen in die Haltung statt in prüfbare theologische Aussagen
Leider zeigt das Gespräch von Dietz und Schäl, wie auch solche konservativ klingenden Formulierungen unterlaufen werden können. Dietz greift die Aussagen von Schäl zwar zustimmend auf. Er kommentiert jedoch zugleich:
„Gemeinsamkeit kann nur dort entstehen, wo man einander den Glauben glaubt. … Einheit ist möglich, wo wir einander zugestehen, dass die Bibel für uns die Grundlage des Glaubens ist, … Ja, es gibt erhebliche Unterschiede, wie wir die Bibel auslegen und verstehen. Welche Worte wir heute für die Dreieinigkeit Gottes finden, ob und wie wir von Gottes Offenbarung reden und wie wir sie ins Verhältnis setzen zur Vielfalt der Religionen heute“.
Zunächst fällt auf: Die oberste Priorität hat hier nicht die biblische Norm, sondern das Vertrauen in die Haltung des Anderen. Wir sollen einfach glauben, dass für unser Gegenüber die Bibel die Grundlage ist – unabhängig davon, wie er die Bibel versteht und auslegt. Und unabhängig davon, wie bzw. ob überhaupt (!) er von Gottes Offenbarung redet.
Offenbarung und Sexualethik: Spezialfragen ohne Bekenntnisrang?
Zugleich warnt Dietz davor, „alle möglichen Spezialfragen, wie ich die Offenbarung verstehe oder wie ich Sexualethik deute, zu Bekenntnisrang hochzupushen.“ Hier ist wohlgemerkt nicht vom Buch der Offenbarung die Rede, sondern allgemein vom Offenbarungshandeln Gottes. Dazu bekennt schon das Nicäno-Konstantinopolitanum: „Wir glauben an den Heiligen Geist, der … gesprochen hat durch die Propheten“. Und die deutsche evangelische Allianz formuliert in ihrer Glaubensbasis: „Die Bibel … ist Offenbarung des dreieinen Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben.“ Zur Sexualethik stellt sie klar: „Der Mensch … ist als Mann und Frau geschaffen.“ Schon diese wenigen Beispiele zeigen: Hier muss man nichts mehr pushen. Aussagen zu diesen Themen haben schon längst Bekenntnisrang.[3]
In seinem Buch „Menschen mit Mission“ hatte Dietz formuliert: „Die Allianz ist eine ökumenische Bewegung, die gerade darum das gemeinsame Bekenntnis so knapp wie möglich formuliert hat.“ Aber auch dieses maximal verknappte Bekenntnis kann in seinen Augen offenkundig keine Grundlage für eine gemeinsame starke Mitte sein. Im Gegenteil: Er warnt ausdrücklich davor, einige der dort formulierten Aussagen festzuschreiben.
Die Zusammenfassung der gemeinsamen Botschaft aller Christen, die Dietz in AUFATMEN dann selbst zu formulieren versucht[4], kommt tatsächlich ohne die Themen Sünde und Schuld, die Trennung des Menschen von Gott, Jesu Opfertod als alleinige Grundlage für Vergebung und den Freispruch in Gottes Gericht und auch ohne die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist aus – alles Themen, die die evangelische Allianz in ihrer Glaubensbasis für unaufgebbar wichtig hält. Die Allianz bekennt sich zudem in aller Klarheit zur Zentralität des stellvertretenden Sühneopfers – Dietz hingegen hat es schon 2019 in einem Worthausvortrag weitgehend relativiert.[5]
Die evangelische Kirche ist nicht beliebig
Trotzdem wendet sich Dietz gegen den Verdacht der Beliebigkeit in kirchlichen Kreisen:
„Viele Dinge werden dort sehr ernst genommen. Es wird z.B. sehr intensiv darüber diskutiert, ob man überhaupt noch Fleisch anbietet in kirchlichen Tagungshäusern. Es wird über Tempolimit und Tierschutz und Frauenrechte und die Rechte von Transmenschen geredet. Ich kenne in den Landeskirchen keine Menschen, die sagen würden: „Ich finde Beliebigkeit super, soll doch jeder, wie er will.”
Diese Aussage kann ich nur bestätigen. Schon 2020 habe ich ganz ähnlich geschrieben: „Die Vorstellung, dass man Einheit in Vielfalt gewinnt, wenn man theologische Differenzen für nebensächlich erklärt, ist eine Illusion. Wo in der Kirche Jesu nicht mehr um theologische Fragen gestritten wird, da schlagen die Wellen stattdessen hoch bei anderen Fragen: Wie stehst Du zu Trump? Wie stehst Du zum Klimawandel? Wie stehst Du zur Flüchtlingsrettung im Mittelmeer? Wo die theologischen Kernfragen nicht mehr polarisieren, da nimmt die Kirche umso mehr teil an der gesellschaftlichen Polarisierung in tagesaktuellen Fragen.“[6] Beliebigkeit gibt es zwar nicht in der Kirche. Aber die Themen, bei denen in der Kirche Entschiedenheit gefordert wird, haben nur wenig mit den zentralen Bekenntnissen der Christenheit zu tun. Und bei diesen Themen ist definitiv noch weniger Einheit unter Christen zu gewinnen als bei den zentralen Glaubensfragen.
Besonders deutlich wurde das in der Abschlusspredigt zum letzten evangelischen Kirchentag von Pastor Quinton Ceasar. Darin hatte er geäußert:
„Wir können nicht mehr warten. … Die Zeit ist jetzt, zu sagen: Wir sind alle die Letzte Generation. Jetzt ist die Zeit, zu sagen: Black lives always matter. Jetzt ist die Zeit, zu sagen: Gott ist queer. Jetzt ist die Zeit, zu sagen: We leave no one to die. Jetzt ist die Zeit, zu sagen: Wir schicken ein Schiff. … es ist auch die Zeit für das Ende der Geduld.“
Was für eine proklamative Botschaft! Von Dialogbereitschaft und Wissen um die Begrenztheit der eigenen Perspektive keine Spur. Trotzdem kommentiert Dietz in einer Kirchenzeitung hocherfreut: „Schön, dass der Kirchentag den Mut hatte, mit einer so herausfordernden Botschaft zu schließen!“[7] In einem Facebookpost schreibt er zudem: „Gott steht jenseits der Geschlechterdifferenz. Gott ist weder Mann noch Frau. Und zugleich sind Mann und Frau zu seinem Bilde geschaffen (Gen 1, 27). Genau das ist doch der Sinn von Queer, jenseits der binären Geschlechterlogik. Und genau darum ist es für queere Menschen so tröstlich, sich das vor Augen zu führen. Wenn sie zum Bilde Gottes geschaffen sind und Gott queer ist, dann ist Gott wirklich ein safe place, das Gegenteil von dem, was sie in vielen Kirchen erfahren haben. Das ist für viele reinstes Evangelium.“
Polarisierung statt Annäherung
Diese Begeisterung für die Abschlusspredigt des Kirchentags bringe ich nur schwer zusammen mit den Aussagen von Dietz in AUFATMEN, in denen er sich Annäherung wünscht:
„Lasst uns wenigstens nicht mehr kaputt machen. Wir sehen, wie schlimm es werden kann und können daraus lernen: In die Richtung wollen wir auf keinen Fall weiter. Es müsste wieder zurück an runde Tische.“
Ich möchte Dietz diesen Wunsch gerne glauben. Aber Tatsache ist aus meiner Sicht: Es gab in letzter Zeit wohl kaum eine Predigt wie die von Quinton Ceasar, die so viel Zusammenhalt kaputt gemacht und Polarisierung unter Christen vorangetrieben hat. Denn während Ceasar seine Positionen als moralisch alternativlos darstellt, ist für zahlreiche Christen klar: Die Gesetzesbrüche und die angstmachenden Botschaften der sogenannten „Letzten Generation“ sind inakzeptabel. Das von der EKD finanzierte Rettungsschiff „Sea watch 4“, das unter einer linksradikalen Flagge fährt, ist kein passender Ausdruck von christlicher Diakonie und Nächstenliebe. Und zum Thema „Gott ist queer“ schreibt der Vorsitzende der deutschen evangelischen Allianz Reinhardt Schink:
„Gott lässt sich von uns nicht in ein bestimmtes “Raster” pressen, um menschliche, zumeist ideologische, Interessen theologisch zu legitimieren. Es gibt in der Geschichte leider viel zu viele Beispiele davon: Gott als Judenfeind, Gott als Antikatholik, Gott als Nationalist („Gott mit uns“ auf den Koppelschlössern), Gott als Kommunist oder Antikommunist, Gott als Kolonialist, Gott als weißer Mann, Gott als männlich, weiblich oder “queer”. Den heiligen Gott in so ein Raster pressen zu wollen, ist eine völlig unangemessene und häufig blasphemische Vorstellung. All dies ist Gott nicht. Vielmehr zieht sich durch die gesamte Bibel wie ein roter Faden das Bekenntnis: Gott ist heilig.“
Deutlicher könnten die Gegensätze kaum sein.
Einheit ohne Grenzen? Jedenfalls nicht beim Thema Sexualethik!
Führt die Offenheit von Dietz nicht zu einer grenzenlosen Ökumene? Dietz antwortet:
„Die Grenze ist da, wo Menschen unfähig sind, ihre Bibelauslegung von der Bibel selbst zu unterscheiden … und wo unterschiedliche ethische Erkenntnisse das Christusbekenntnis an Gewicht überbieten.“
Demnach scheint grenzenlose Einheit tatsächlich möglich zu sein. Denn natürlich wird kein einigermaßen reflektierter Christ behaupten, dass seine Bibelauslegung 1:1 mit der tatsächlichen Aussageabsicht der Bibel übereinstimmt. Und kein Christ wird ethische Fragen über das Christusbekenntnis stellen.
Bemerkenswerterweise ist es aber Thorsten Dietz selbst, der an anderer Stelle der These von der grenzenlosen Einheit widerspricht. In der live auf dem Kirchentag aufgenommenen Podcastfolge 24 von „Karte und Gebiet“ sagt Dietz: Innergemeindliche „Einheit in Vielfalt“ oder „versöhnte Verschiedenheit“ kann beim Thema „Ehe für alle“ unmöglich funktionieren. Denn das wäre ja „versöhnte Verschiedenheit auf Kosten von Betroffenen“.[8] Dietz bestätigt damit, worauf viele Konservative seit langem hinweisen: Wo progressive Sexualethik in einer bislang konservativen Gemeinde Raum gewinnt, da gibt es auf Dauer nur 2 Möglichkeiten: Entweder setzt sich eine der beiden Positionen durch. Oder es muss irgendeine Form von Trennung geben. Grenzenlose Einheit ist gerade auch bei Progressiven unmöglich, wenn es um die Sexualethik geht.
Das wurde zuletzt auch deutlich in einem Gottesdienst der Gemeinde „UND Marburg“, die unter anderem geleitet wird von Tobias Faix, dem Podcastpartner von Thorsten Dietz. In der Predigt wurde die These vertreten: Die „Aufregung“ um die Predigt von Quinton Ceasar und seinen Satz „Gott ist queer“ zeige, wie viel „Queerfeindlichkeit“ es immer noch unter Christen gebe. Von Offenheit für andere Positionen auch hier keine Spur, stattdessen die Unterstellung niedriger Motive. Das hört sich für mich nicht so an, als ob man hier wieder runde Tische mit Konservativen sucht.
Tiefe theologische Gräben
Zugleich wurden die Gottesdienstbesucher von UND-Marburg aufgefordert, beim „Vater-Unser“ den Begriff „Vater“ durch eine beliebige andere Anrede zu ersetzen. Es ist schon bemerkenswert: Während es in progressiven Kreisen fast als Verbrechen gilt, die selbstgewählten Pronomen einer Person zu ignorieren, setzt man sich bei der Anrede Gottes großzügig darüber hinweg, wie Gott selbst angesprochen werden möchte: „Ihr sollt vielmehr so beten: Unser Vater…“ (Matth. 6, 9)
Hinzu kommt: Gott kann natürlich unmöglich „queer“ sein in dem Sinne, wie der Begriff im Allgemeinen verwendet wird. Denn anders als wir Menschen hat Gott kein biologisches Geschlecht, mit dem er sich in Spannung befinden könnte. Er hat auch kein wie auch immer geartetes sexuelles Begehren. Zugleich macht Jesus deutlich, dass Gott mit der „binären Geschlechterlogik“ offenbar keinerlei Probleme hat:
„Habt ihr nie gelesen”, erwiderte Jesus, “dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat? Und dass er dann sagte: ‘Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden völlig eins sein.’? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott so zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden!”“ (Matthäus 19, 4-6)
Die Ehe von Mann und Frau ist für Jesus offenkundig eine Idee des Schöpfers – weshalb Scheidung für ihn normalerweise nicht in Frage kommen kann. Thorsten Dietz hingegen schreibt im Medienmagazin PRO: „Die Ehe ist keine christliche Idee. … Für Christen gilt: Der Wunsch nach Ordnung ist eng verknüpft mit Konservatismus. Zu dieser Ordnung gehört auch die Familie. Kurz gesagt: Je unruhiger die Welt, desto größer der Wunsch nach Erhalt und Ordnung. Die Ehe ist ein Ordnungsmittel. So erkläre ich mir den Hype darum.“[9] Der Ehe-„Hype“ des „Konservatismus“ ist also eine Folge von Ordnungssehnsucht? Auch diese Unterstellung niedriger Motive empfinde ich nicht gerade als Beitrag zum respektvollen Dialog. Und die Beispiele mögen zeigen: Hier werden theologische Wege eingeschlagen, die Evangelikale unmöglich mitgehen können – denn sie wären dann nicht mehr evangelikal.
Wie geht es weiter?
Wie werden wir wohl in 20 Jahren auf diese konfliktreiche Zeit zurückblicken? Schäl äußert dazu: „Ich glaube, wir schauen entspannter zurück, so wie wir jetzt auf den Anfang des 20. Jahrhunderts, als die charismatische Bewegung aufkam. Heute schmunzelt man und ärgert sich ein bisschen.“ Sind also die Auseinandersetzungen unserer Zeit nur ein Sturm im Wasserglas, der sich mit der Zeit von selbst wieder legen wird?
Ich halte Schäl‘s Vergleich für fragwürdig. Denn genau wie Volker Gäckle (Rektor der Internationalen Hochschule Liebenzell) nehme auch ich wahr, dass die heutigen Konflikte viel zentralere Themen betreffen als der Streit um Charismen:
„Die Debatte nahm ihren Ausgangspunkt bei der Frage nach der Bewertung gleichgeschlechtlicher Sexualität und ist mittlerweile bei viel zentraleren theologischen Fragen gelandet: Gibt es ein letztes Gericht Gottes? Ist der Glaube an Jesus Christus das entscheidende Kriterium für Rettung und Verlorenheit? Ist die Heilige Schrift auch in geschichtlicher Hinsicht eine zuverlässige und vertrauenswürdige Grundlage für Glaube und Leben der Gemeinde? Darüber hat der Pietismus in den 60er- und 70er-Jahren mit der Ökumenischen Missionsbewegung und der liberalen Theologie auf Kirchentagen und Synoden gestritten. Heute streiten wir über ähnliche Fragestellungen im eigenen Laden.“ [10]
Die Konflikte, die jetzt auch mitten im allianzevangelikalen Umfeld aufbrechen, sind also im Kern die gleichen Konflikte, die im letzten Jahrhundert schon einmal im kirchlichen Umfeld aufbrachen. Im Zentrum standen damals wie heute die zentralen Fragen nach dem Schrift- und Offenbarungsverständnis, nach der Christologie und nach der Kreuzestheologie. Diese Konflikte haben sich nicht wieder beruhigt, im Gegenteil: Jahrzehnte später nutzt die EKD ihre noch verbliebene Macht mehr denn je, um Evangelikale von den Ausbildungsstätten und Leitungsgremien fernzuhalten.
Aus gutem Grund haben die evangelikalen Leiter im kirchlichen Umfeld damals gespürt: Wir müssen Parallelstrukturen bauen! So entstanden wunderbare evangelikale Verlage, Medien, Werke, Gemeinschaften und Großveranstaltungen, von denen auch ich sehr stark profitiert habe. Ich glaube nicht, dass diese evangelikalen Pioniere vom Lagerdenken getriebene Spalter waren. Denn sie hatten für ihre Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, handfeste Gründe:
Eine Theologie, die den Missionsauftrag entkernt
Mission und Evangelisation ist und bleibt das Herzensanliegen der Evangelikalen. Doch die Kirche fremdelt seit langem damit. Im Buch „Mission Zukunft“ fiel auch Michael Diener auf: Es ist „wohl nicht ganz zufällig, dass sich alle Beiträge aus der Leitung der EKD mit … ethischen Haltungen der Mission beschäftigen.“Und Alexander Garth bemerkt: „Es fällt auf, dass die wenigsten innovativen missionarischen Projekte aus dem Bereich der Großkirchen kommen … obgleich sie über immense Ressourcen an Finanzen und Manpower verfügt.“ Die Gründe für diese Missionsphobie der EKD werden in diesem Buch überaus deutlich. So schreibt zum Beispiel der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm: „Mission, wie ich sie verstehe, ist nicht der strategische Versuch, Menschen zu einem bestimmten Bekenntnis zu veranlassen.“ Gleich mehrfach wird ein Satz des Theologen Fulbert Steffensky zitiert:
„Mission ist die gewaltlose, ressentimentlose und absichtslose Werbung für die Schönheit eines Lebenskonzeptes. Mission heißt zeigen, was man liebt.“
War Paulus auf seinen Missionsreisen also „absichtslos“ unterwegs gewesen? Wollte er in erster Linie die Welt bereisen und anderen Menschen nur bei Gelegenheit von seinem schönen Lebenskonzept erzählen? Bernhard Meuser hält zurecht dagegen: „Die Kirche muss wieder wollen, dass Menschen ihr Leben durch eine klare Entscheidung Jesus Christus übergeben.“ Diese auf dem Missionsbefehl basierende Perspektive ist in der EKD komplett verloren gegangen. Kein Wunder, dass evangelikale Pioniere auf Parallelstrukturen setzen mussten angesichts einer um sich greifenden Theologie, die mit Mission im biblischen Sinn vollständig inkompatibel ist.
Im Gespräch zwischen Schäl und Dietz könnte man hingegen den Eindruck bekommen: Die gemeinsamen Ziele und die gemeinsame Sendung der Kirche wäre so klar, dass man darüber die theologischen Differenzen zurückstellen könnte.[11] Das erlebe ich tatsächlich vollkommen anders. Ich kenne keine Definition des Evangeliums und des Sendungsauftrags der Kirche, die in meiner evangelischen Kirche konsensfähig wäre und zugleich von Evangelikalen mitgetragen werden könnte. Mir zeigt das: Wenn unsere Theologie nicht in der Lage ist, den Bekenntniskern des Christentums zu schützen, dann gehen auch die gemeinsamen Ziele und die gemeinsame Sendung verloren. Dann hat die Kirche keine Zukunft. Oder bildlich gesprochen: Wer auf die Praxis fokussieren will, während zugleich die zentralen theologischen Grundlagen verschwimmen, der ist wie ein Kapitän, der sich auf dem sinkenden Boot aufs Fischen konzentriert, statt das Leck zu verschließen.
Bibel und Bekenntnis sind unverzichtbar für Einheit in Vielfalt
Für gelingende Einheit in Vielfalt und für eine starke missionarische Dynamik ist deshalb eine verbindende Bekenntnisgrundlage (wie das Apostolikum, das Nicäno-Konstantinopolitanum oder die Glaubensbasis der evangelischen Allianz) unverzichtbar. Dabei muss klar sein: Bekenntnisse bilden natürlich immer auch eine Grenze! Sie sorgen für ein „innen“ und „außen“ und für die Unterscheidung zwischen „uns“ und „ihnen“.
Selbstverständlich sind Christen allen Menschen in Liebe zugewandt. Aber die Zugehörigkeit zur Einheit der Familie Gottes gilt nun einmal nur den Jüngern Jesu, die alles halten wollen, was Jesus uns geboten hat (Matthäus 28, 19). Die Lehre und Gebote Jesu finden wir ausschließlich in der Bibel. Es stimmt zwar, dass unser Verständnis der biblischen Aussagen manchmal undeutlich ist und Stückwerk bleibt. Aber in allen zentralen und heilsrelevanten Fragen sind die biblischen Aussagen doch so klar, dass Christen sie immer wieder in eindeutigen Bekenntnissen fassen und festschreiben konnten. Wenn aber selbst diese wenigen, allerzentralsten Bekenntnissätze in Frage gestellt werden, dann lässt das ganz offenkundig auf ein Bibelverständnis schließen, in dem die Bibel faktisch keine „normierende Norm“ mehr ist.
Die Geschichte der Christenheit zeigt: Die Bibel kann der Christenheit eine gemeinsame, verbindende Basis und eine starke Mitte geben, die uns hilft, viele randständige Differenzen fröhlich auszuhalten. Das gilt aber nur, wenn wir an dem Bibelverständnis festhalten, das die Bibel selbst bezeugt und das schon für die ersten Kirchenleiter galt: Die Bibel IST Offenbarung. Sie enthält oder bezeugt sie nicht nur. Hinter allen ihren Texten steht letztlich dieser eine Heilige Geist. Deshalb ist dieses Buch kein widersprüchliches und fehlerhaftes Durcheinander, sondern eine verlässliche und weithin verständliche Einheit. Wenn unser Schriftverständnis aber dazu führt, dass der Bekenntniskern verschwimmt, dann versandet auch die Einheit. Deshalb finden wir die orientierunggebende Zurückweisung falscher Lehre und das bekenntnishafte Benennen von Grenzen der Einheit nicht umsonst immer wieder im Neuen Testament. Beides ist unverzichtbar für ein gelingendes Miteinander und für eine starke, missionarische Kirche Jesu.
Mein Votum ist deshalb: Lasst uns beides wieder ganz neu schätzen lernen und praktizieren. Nicht aus Rechthaberei, Lagerdenken oder Machtstreben. Sondern aus Liebe zu den Menschen, zur Kirche Jesu und zu unserem Herrn, dem wir gemeinsam folgen.
Fußnoten:
[1] „Einheit oder Einheitlichkeit?“ In Aufatmen 2023, Ausgabe 2 (S. 52-58) und 3 (S. 44-47)
[2] Stephanus Schäl ist Dozent für Altes Testament an der Bibelschule Brake. Er ist stellvertretender Sprecher des Konvents der Evangelischen Allianz in Deutschland und Teil der EAD-Mitgliederversammlung. Prof. Dr. Thorsten Dietz lehrte bis 2022 als Professor für Systematische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor. Jetzt ist er unter anderem zuständig für die Erwachsenenbildung der Evangelisch-reformierten Kirche in der Schweiz. Medial präsent ist er vor allem durch seine Arbeit bei RefLab, als einer der Hauptreferenten der Mediathek Worthaus, beim Podcast „Karte und Gebiet“ (gemeinsam mit Tobias Faix) sowie durch diverse Bücher (zuletzt Menschen mit Mission, SCM R. Brockhaus 2022). Seit 2020 ist er Mitglied des Trägervereins des ERF.
[3] Zur Sexualethik wird zudem z.B. im Helvetischen Bekenntnis und im Westminster Bekenntnis einiges ausgesagt, siehe dazu der Artikel „Das reformierte Glaubensbekenntnis zur Ehe für alle“ im Blog Daniel Option.
[4] Wörtlich schreibt Dietz: „Alle Kirchen verbindet der Glaube: Wir haben etwas wirklich Gutes zu erzählen und zu feiern. Die Jesus-Geschichte des Neuen Testaments wurde für die ersten Nachfolgenden ein Brennpunkt, in dem die Befreiungsgeschichten Israels zusammenliefen. Und zugleich öffneten sie sich zu einer umfassenden Einladung an alle Menschen, in diesem Jesus das unbedingte Ja Gottes des Schöpfers zu finden. Diese Botschaft von der großen Bejahung ist bis heute die Gründungsgeschichte der Christenheit, die es in immer neuen kreativen Formen weiterzuerzählen gilt.“
[5] Der Worthausvortrag „Der Prozess – Warum ist Jesus gestroben?“ von Thorsten Dietz (10.6.2019, worthaus.org/mediathek/der-prozess-warum-ist-jesus-gestorben-9-4-3/) wurde ausführlich zusammengefasst und kommentiert in: Markus Till: „Quo vadis Worthaus? Quo vadis evangelikale Bewegung“, in „Glauben &Denken heute“, Ausgabe 1/2020, S. 25-31, PDF-Download unter: blog.aigg.de/wp-content/uploads/2020/06/QuoVadis_MarkusTill_GuDh1_2020.pdf
[6] Im AiGG-Blogartikel „Wie gelingt Einheit in Vielfalt“, 12.12.2020, blog.aigg.de/?p=5332
[7] In: „Ist Gott queer?“, 16.6.2023, www.meine-kirchenzeitung.de/c-aktuell/ist-gott-queer_a41301
[8] So sagt er im Podcast „Karte und Gebiet“ Folge 24 „Live auf dem Kirchentag“ ab 36:50: Einheit in Vielfalt oder auch versöhnte Verschiedenheit „sind aber Dinge, die gehen ja nicht überall. Also nehmen wir „Ehe für alle“: Man kann in einer Gemeinde nicht Betroffenen zumuten, hier ‚Komm zum Gottesdienst‘ und die einen werden dich umarmen und sagen: Schön, dass Du da bist. Und die anderen werden sagen: Guten Morgen, aber Sünde ist es doch. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Das wäre ein Kompromiss und versöhnte Verschiedenheit auf Kosten von Betroffenen.“ Er schlägt deshalb vor, im Rahmen eines „good disagreement“ „verschiedene Wege“ zu gehen, die „unterschiedliche Räume vorhalten“ , so dass „safe places“ für alle da sind.
[9] In: „Theologe Thorsten Dietz: Die Ehe ist keine christliche Idee“, Christliches Medienmagazin PRO, 18.6.2023, www.pro-medienmagazin.de/theologe-thorsten-dietz-die-ehe-ist-keine-christliche-idee/
[10] Volker Gäckle: „Windstille, Wandel und Gottes Wirken“, in „Lebendige Gemeinde“ 4/2021, S. 14, online unter https://lebendige-gemeinde.de/wp-content/uploads/2021/12/LG_2021_04_ChristusBewegung.pdf
[11] So sagt Schäl u.a. zu Dietz: „Ich finde, du setzt da einen ganz wichtigen Akzent: „Für alle Kirchen und Verbände dürfte das die entscheidende Herausforderung sein: Einheit nicht zu zerreden, sondern im Einsatz für gemeinsame Ziele erfahrbar werden zu lassen. Zentrale Bedeutung hat die Besinnung auf die gemeinsame Sendung der Kirche.” Ich schreibe ja, dass wir vom Kampf zum Dialogmodus gehen müssen. Und du setzt noch einen drauf: Wir müssen zum Sendungsmodus kommen. Ich finde das Ringen, das eher theoretische Ringen wichtig, aber der Punkt ist ja nicht, dass wir uns in einem Diskurs auf Einheit einigen, sondern dass wir als Kirche Jesu das umsetzen, was wir leben sollen.“