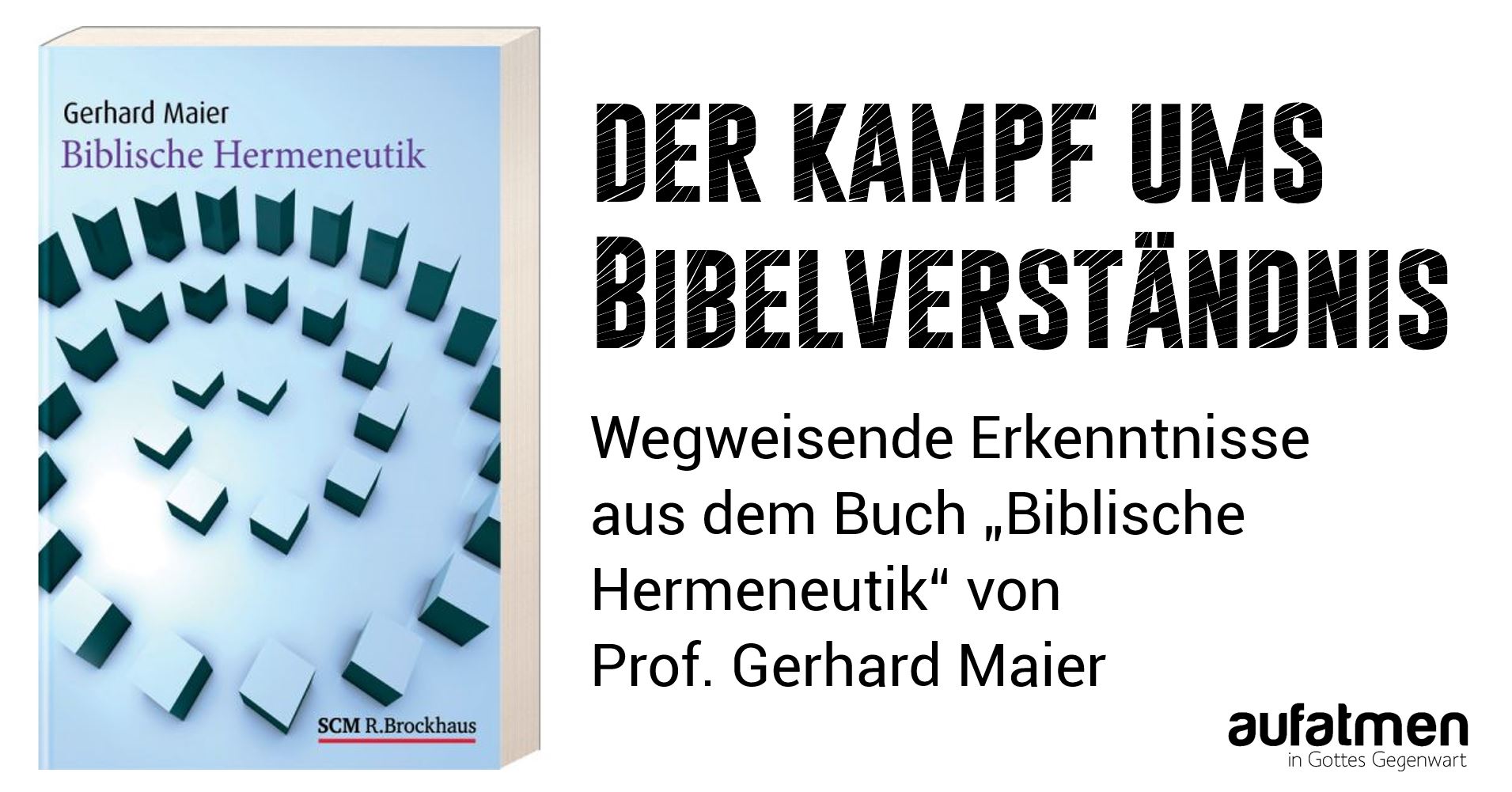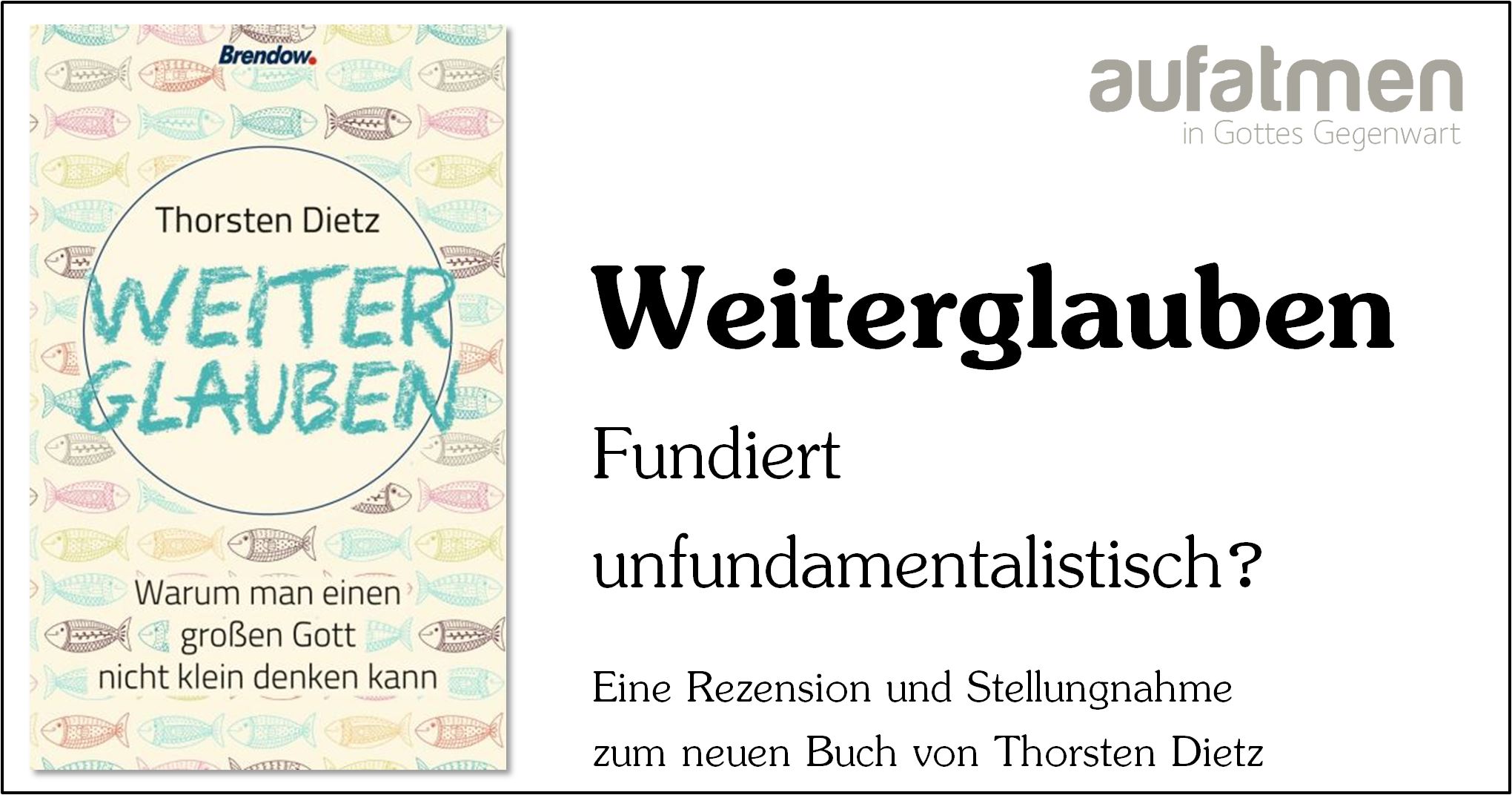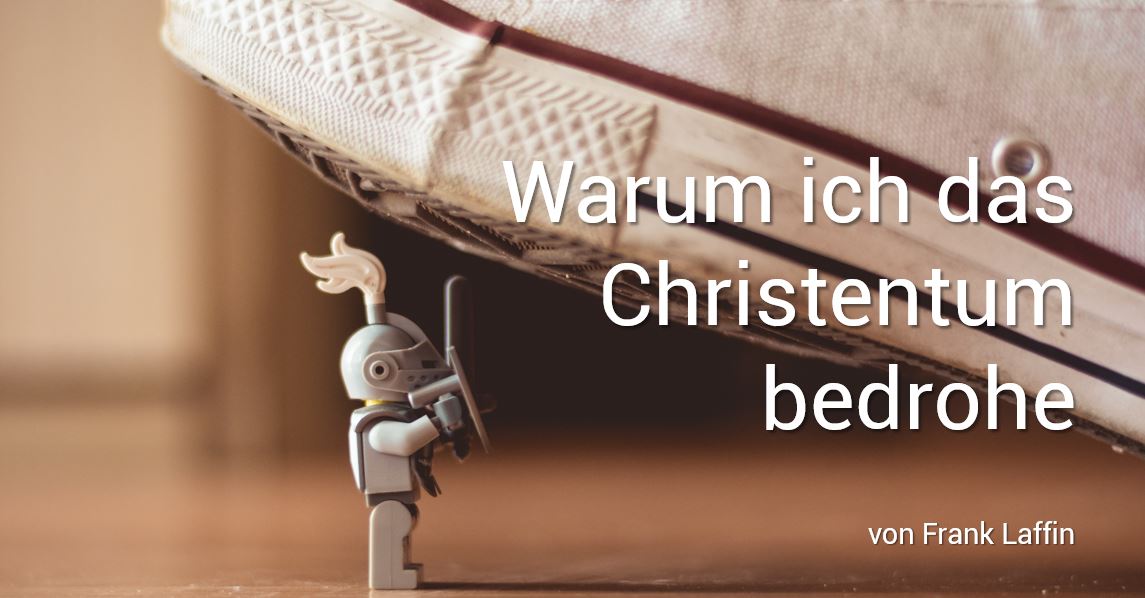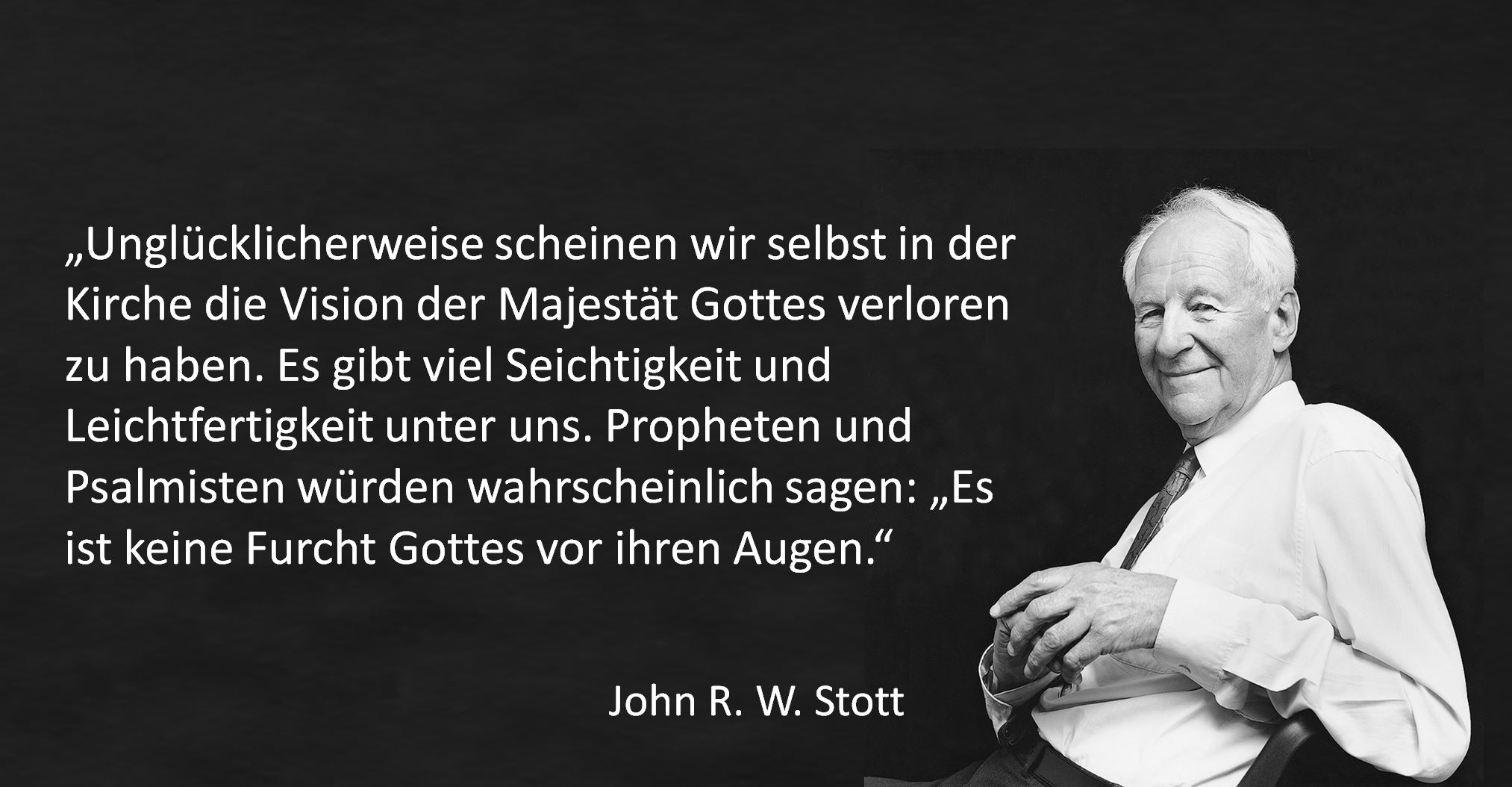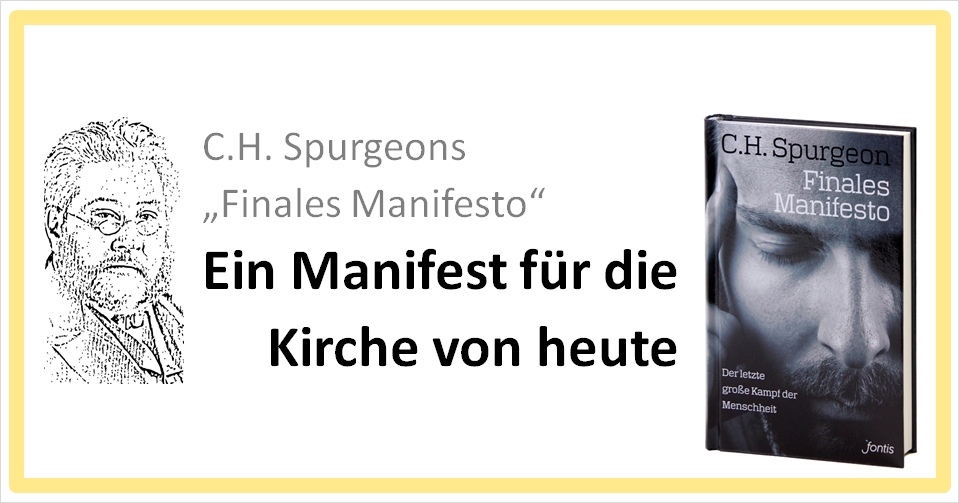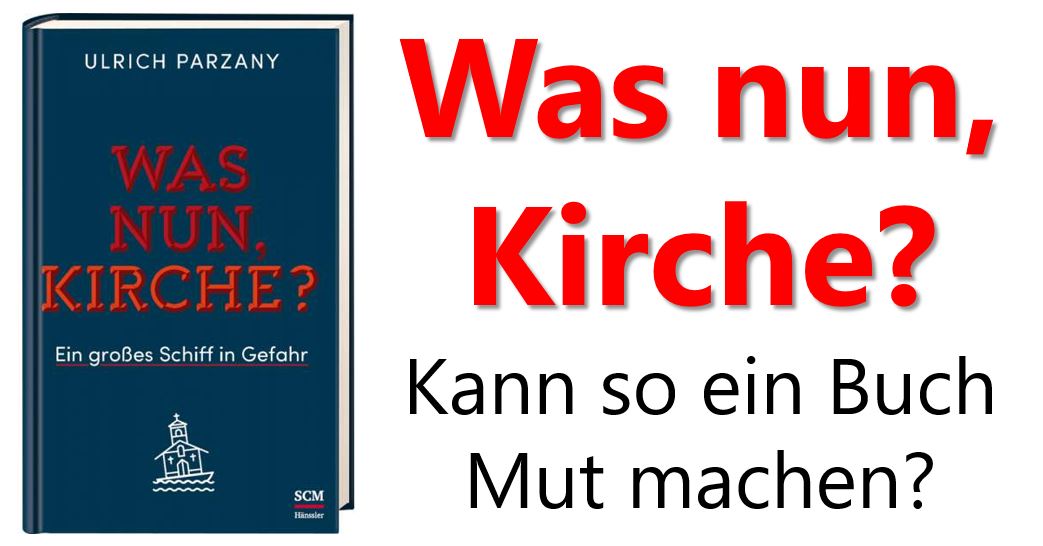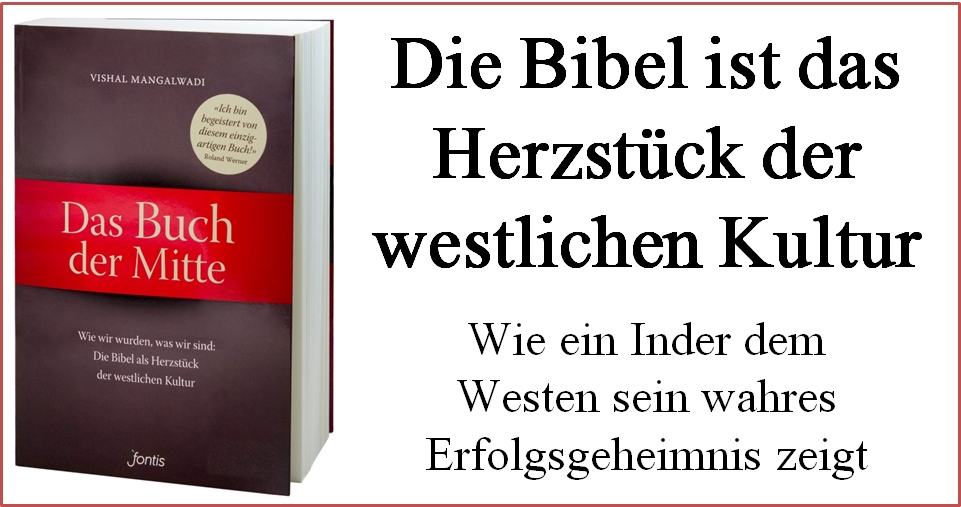Wegweisende Erkenntnisse aus dem Buch „Biblische Hermeneutik“ von Prof. Gerhard Maier
„Biblische Hermeneutik“: Dieses Buch von Prof. Gerhard Maier hätte ich am liebsten jedem Theologen zu Weihnachten unter den Baum gelegt. Der Autor ist mir schon lange ein Begriff, schließlich war er 4 Jahre lang Landesbischof meiner württembergischen Landeskirche. Dass er zugleich ein herausragender Theologe ist, war mir auch schon zu Ohren gekommen. Tatsächlich ist sein Buch „Biblische Hermeneutik“ nichts weniger als ein grundlegender Ruf zur Umkehr in der Theologie. Maier setzt sich intensiv mit der sogenannten „historisch kritischen Methode“ (HKM) auseinander, die aktuell eine fast uneingeschränkte Dominanz besitzt:
„Die Meinung, „dahinter können wir nicht mehr zurück“, ist eine der am weitesten verbreiteten, auch im Kreise sog. „evangelikaler“ Theologen. … Noch 1971 konnte Richter schreiben: „Das Recht, die historisch-kritische Methode anzuwenden, ist heute … in der Theologie unbestritten“. Dabei ist allen klar, dass die „Kritik“ nicht nur die (selbstverständliche!) Aufgabe des Unterscheidens wahrnimmt, sondern ein „kritisches“ Beurteilen der biblischen Aussagen, ihre Bejahung oder Verwerfung, kurz: die Sachkritik an der Bibel, einschließt.“ (S. 214)
Eben diese Sachkritik ist für Maier das entscheidende Problem bei der HKM, denn: „Jede Sachkritik an der Bibel gibt … Teile ihres Inhalts preis. … Die zahllosen Schwankungen, denen innerhalb der letzten 300 Jahre die Sachkritik unterworfen war, widerlegen eindrucksvoll die Behauptung, die Schrift ermögliche aus sich selbst heraus eine solche Sachkritik.“ (S. 266)
Sachkritik bedingt immer, dass es einen menschlichen Kritiker geben muss: „Was sich … durch die ganze Geschichte der historischen Kritik hindurchzieht, das ist die Anschauung, dass der Mensch über den Wahrheitsgehalt der Offenbarung zu entscheiden habe.“ (S. 259) Der Bibel wird damit eine zweite Autoritätsinstanz beigestellt: „Das katholische Lehramt ist evangelischerseits im Laufe der Zeit durch Vernunft und Wissenschaftlichkeit, deren Inhalte umstritten blieben, ersetzt worden. … Wahrhaftigkeit und modernes Weltverständnis sind hier ethische und intellektuelle Verstehensvoraussetzungen, die in ihrer Kombination zu einer zweiten Instanz neben der Schrift führen.“ (S. 142) Somit ist die reformatorische Formel „Sola scriptura“ preisgegeben, die bis zum Pietismus noch galt. (S. 302)
Die zentrale Weichenstellung: Trennung von Text und Offenbarung
Grundsätzlich möglich wird die Bibelkritik der HKM durch folgende zentrale Weichenstellung: „Grundlegend für die historisch-kritische Arbeitsweise ist die Trennung von Schrift und Offenbarung bzw. von Bibel und Wort Gottes. Keinesfalls besteht hier eine Identität.“ (S. 262) Beispielhaft zeigt Maier das an der „dreifachen Gestalt des Wortes Gottes“ von Karl Barth, in der u.a. zwischen dem schriftlichen und dem offenbarten Wort Gottes unterschieden wird, wobei das schriftliche Wort (die Bibel) nicht die eigentliche Offenbarung ist. Die Bibel bezeugt sie nur. Maier begründet, warum er sich mit dieser Lehre nicht befreunden kann: „Sie zerbricht die Theopneustie („göttliche Eingebung“, „Durchhauchtsein mit dem Geist“, 2. Tim. 3, 16) an der entscheidenden Stelle, nämlich dort, wo gerade die Schrift als das final gemeinte Wort des Heiligen Geistes Gestalt gewinnen soll … indem sie uns letztlich an ein unkonkretes, zeitloses „Dahinter“ bindet. Und sie widerspricht auch der Position Luthers und der Reformatoren, für die das biblische Wort der eigentliche Wille Gottes war.“ (S. 104)
Erst durch diese Trennung zwischen biblischem Wort und Offenbarung ist es möglich, kritisch an das biblische Wort mit dem Prinzip des wissenschaftlichen Zweifels heranzutreten. Das ist für ihn die eigentliche „Innovation“ der historisch kritischen Methode: „Nicht die Entdeckung neuer, bisher unbekannter Arbeitsschritte oder methodischer Einzelverfahren war das Entscheidende. Sondern der prinzipiell vom Zweifel geprägte Umgang mit der Heiligen Schrift.“ (S. 221)
Deutlich wird dieser Zweifel zum Beispiel im Umgang mit den geschichtlichen Aussagen der Bibel. Das ist aus seiner Sicht besonders tragisch, denn: „Der biblische Glaube hängt tatsächlich aufs engste mit der wirklichen Geschichte zusammen. … Entzieht man ihm die geschichtliche Basis, auf die er aufgebaut ist, dann hat man ihn prinzipiell widerlegt. … Der Glaube hängt an seiner Geschichtlichkeit.“ (S. 181)
Hinzu kommt in der HKM die bis heute nicht überwundene allgemeine Skepsis gegen Wunder und Prophetie: „Im Grunde teilt das ganze 19. Jh., soweit es die historisch-kritische Forschung in Deutschland betrifft, das Urteil, dass wir heute an Wunder nicht mehr glauben können. … Ja selbst in unserem Jahrhundert noch wird die historische Kritik von dem Gedanken beherrscht, dass Wunder ungeschichtlich seien.“ (S. 196)
Daran zeigt sich, wie wenig die historisch kritische Methode ihren eigenen Anspruch einlöst, „wissenschaftlich“ und „objektiv“ zu sein: „Es besteht … unter den Anhängern der historischen Kritik eine erstaunliche Übereinstimmung darüber, dass sie „ein Kind der Aufklärung“ darstellt. … Damit ist die dominierende Rolle der Vernunft ausgesagt. … Hier erhält also … der Mensch einen absoluten Vorrang. … Auf der anderen Seite wird deutlich, dass diese „Vernunft“ keine weltanschauliche Neutralität besitzt. Im Gegenteil, sie ist eine religiös determinierte Größe. Um noch einmal Picht zu zitieren: „Die Vernunft des europäischen Denkens ist als Projektion des Gottes der griechischen Philosophie bis in ihre innersten Elemente vom Mythos durchtränkt. Es ist ein Zeichen mangelnder Aufklärung, wenn wir das nicht wissen. Von hier aus fällt ein neues Licht auf die Spannung zwischen Glauben und Vernunft, aber auch auf die unglückliche Liebe der Theologen zu dieser selben Vernunft.“ Das heißt, die Berührung der Theologie mit der Philosophie der Aufklärung und die Entwicklung einer vernunftverantwortlichen Bibelwissenschaft war eben kein Methodenproblem im neutralen Sinne, sondern eine religiöse Kontamination. … Die neue Situation, die durch eine solche Anwendung von Kritik entstand, muss eindeutig als ein Bruch mit der vorangehenden christlichen Geschichte bezeichnet werden.“ (S. 236/237)
Das Bibelverständnis muss aus der Bibel kommen!
Angesichts dieser grundsätzlichen Dramatik stellt sich nun umso drängender die Frage: Wie begegnet Gerhard Maier nun der HKM? Im ganzen Buch findet sich dazu immer das gleiche Prinzip: Maier setzt den Sichtweisen der HKM nicht einfach seinen eigenen Ansatz gegenüber. Zwar ist er sich zwar bewusst, dass „eine voraussetzungslose Auslegung ein Phantom, eine Selbsttäuschung darstellt. Doch gerade unsere Voraussetzungen will die Bibel in Frage stellen, korrigieren und teilweise zerstören.“ (S. 15) Prof. Maier betont also: Wir können unsere Denkvoraussetzungen beim Auslegen der Bibel nicht beliebig wählen. Die Bibel hat eine Meinung dazu, wie sie korrekt gelesen und ausgelegt werden will! Deshalb befragt Maier immer wieder den biblischen Text, den er durchweg als „Offenbarung“ bezeichnet. Er will sich sein Schriftverständnis von der Bibel selbst vorgeben lassen, denn: „Wahrscheinlich ist die wichtigste hermeneutische Entscheidung diejenige, ob wir den Ausgangspunkt bei der Offenbarung selbst oder beim Menschen nehmen.“ (S. 19) Er wendet damit vorbildlich das reformatorische Prinzip an, dass die Schrift sich selbst auslegen muss. Im Zentrum steht für Prof. Maier deshalb die Frage:
Welches Bibelverständnis gibt uns die Bibel vor?
Maier stellt zum einen fest, dass die Bibel die menschliche Vernunft als oberste Autoritätsinstanz für vollkommen ungeeignet hält: „Die Offenbarung kennt den „autonomen“ Menschen nur als den „verlorenen“ Menschen. … Seine Autonomie war von Anfang an eine Utopie und ein Weg in die Sklaverei, ja zum Rande des Untergangs.“ (S. 242/243)
Das biblische Bibelverständnis stellt sich für Maier nach ausführlicher Analyse der biblischen Aussagen wie folgt dar: „Diese Offenbarung beansprucht, aus Gottes Geist hervorgegangen zu sein. Sie ist … Anrede Gottes an uns. Wer sie hört, hört in erster Linie nicht die menschlichen Verfasser und Glaubenszeugen, sondern den dreieinigen ewigen Gott. … Als einzigartiges Reden Gottes hat sie eine einzigartige, unvergleichliche Autorität. An dieses Wort hat sich Gott gebunden. Er hat es zum Ort der Begegnung mit uns bestimmt. Er wird dieses Wort bis ins letzte hinein wahr machen und erfüllen. Die Schriftautorität ist im Grunde die Personenautorität des hier begegnenden Gottes.“ (S. 151)
Wichtig ist Prof. Maier dabei der Begriff der „Inspiration“. Nicht nur die biblischen Autoren waren von Gottes Geist inspiriert („Personalinspiration“), nein: Der Text selbst ist von Gottes Geist inspiriert („Verbalinspiration“), und zwar der vollständige Bibeltext aller kanonischer Bücher im endgültig vorliegenden Urtext („Ganzinspiration“). Genau das nimmt laut Maier auch der biblische Text für sich selbst in Anspruch: „Die weitaus meisten Schriften des Neuen Testaments sind nach der Selbstaussage des NT inspiriert … oder lassen den indirekten Anspruch erkennen, inspirierte Schrift zu sein. … Wenn später die Kirche … die Inspiration aller neutestamentlichen Schriften anerkannte, dann stand sie auf einem guten historischen Boden und darüber hinaus im Einklang mit der Offenbarung selbst.“ (S. 88)
Darüber hinaus beansprucht der Bibeltext noch folgende Eigenschaften für sich: „Die Offenbarung schreibt dem Worte Gottes vor allem vier Eigenschaften zu: Erstens: Es ist verlässlich. … Zweitens: Es ist wirksam. … Drittens: Es zeigt den Willen Gottes auf und damit den Weg zum Heil. … Viertens: Es ist verbindlich. … Man kann also beobachten, dass Begriffe wie „Irrtumslosigkeit“, „Fehlerlosigkeit“ oder „Unfehlbarkeit“ in der Bibel nicht gebraucht werden. Aber noch weniger spricht die Bibel von „Fehlern“ oder dergleichen.“ Ein bibelnaher Begriff für den Selbstanspruch der Bibel ist aus der Sicht von Maier: „Vollkommene Verlässlichkeit.“ (S. 122). Dazu erläutert er: „Das zur Schrift gewordene Wort Gottes ist vollkommen verlässlich und fehlerlos im Sinne seiner göttlichen Zwecke, also von Gott her betrachtet.“ (S. 125)
Mit Jesus die Bibel kritisieren? Die Einheit und Klarheit der Schrift
Aus der Urheberschaft Gottes folgt für Maier auch die Einheit der Schrift: „Die Einheit der Schrift wird am stärksten begründet durch den einen Urheber, den sie hat, Gott. … In der Tat ist die Behauptung einer Widersprüchlichkeit davon abhängig, dass man die menschlichen Glaubenszeugen zu den maßgeblichen Autoren der Schrift ernennt und den göttlichen Autor verdrängt.“ (S. 164) „Erst seit der Aufklärung ging die Überzeugung von der Einheit der Schrift in weiten christlichen Kreisen verloren.“ (S. 160) Das ist dramatisch, denn: „Wo man die Einheit der Schrift verliert, verliert man auch das Mittel, gegen die Häresie zu kämpfen. … Bezeichnenderweise gab es seit der Aufklärung zwar noch eine Kirchenzucht, aber im Grunde keine Lehrzucht mehr. … Damit wird jedoch das NT auf den Kopf gestellt.“ (S. 165)
Aber widerspricht sich die Bibel nicht selbst? Können bzw. müssen wir nicht mit Jesus andere Teile der Bibel kritisieren? Diesen Ansatz verwirft Maier aufs Schärfste: „Die Schrift war für Jesus wie für seine jüdischen Gesprächspartner die letzte Entscheidungsinstanz. … Es kann überhaupt kein Zweifel daran sein, dass den heiligen Schriften in den Augen Jesu eine unvergleichliche Autorität zukommt. Wer bei ihm „Kritik“ am AT finden will, muss alles auf den Kopf stellen.“ (S. 149) „Eine Anleitung aus der Schrift, Schrift mit Schrift abzulehnen (was ja der Begriff der „Sachkritik“ impliziert), gibt es nirgends.“ (S. 265)
Kritisch sieht Maier deshalb auch den Versuch, eine „Mitte der Schrift“ zu konstruieren: „Die „Mitte der Schrift“ wurde praktisch zum Ersatz für die verlorengegangene „Einheit der Schrift“. … Wird aus der Christusmitte ein Christusprinzip, dann wird die Schrift entleert und ihrer Fülle beraubt. … Es kann sich nur um eine personale Mitte handeln. … Jeder Versuch, diese Mitte als ein isolierbares Etwas herauszulösen oder in Form eines Lehrgesetzes zu formulieren, zersprengt die Kontinuität der heilsgeschichtlichen Offenbarung.“ (S. 174-176).
Dazu verteidigt Maier die „Klarheit der Schrift“: „Die Autorität der Schrift kann sich praktisch nur durchsetzen, wenn jeder schlichte Christ in der Lage ist, einen klaren Begriff vom Inhalt der Schrift zu gewinnen. … Jesus konnte die wiederholte Frage: „Habt ihr nicht gelesen?“ nur stellen, wenn er von der Klarheit der Heiligen Schrift überzeugt war. … Die schriftgewordene Offenbarung behauptet, für jedermann zugänglich und eindeutig genug zu sein.“ (S. 155/156)
Konsequenzen der HKM: Ethisierung, Subjektivierung, Individualisierung, Erfahrungstheologie
Gerhard Maier ist als ehemaliger Landesbischof nicht nur Theologe sondern auch Gemeindepraktiker. Vor diesem Hintergrund sollte man umso aufmerksamer hinhören, wenn er die negativen Folgen der historisch kritischen Methode wie folgt beschreibt: „Der Inhalt, von dem die Neologie (d.h. die aus der Aufklärung resultierende Lehre) den Offenbarungsbegriff entleert, ist der historische; der Inhalt, den sie neu einfüllt, ein rationaler. Sobald aber die Geschichte durch das Rationale ersetzt wird, wird die Bibel zum Lehrgesetz. Deshalb ist es überhaupt nicht erstaunlich, dass in der Aufklärung die sittliche Vernunft zum dogmatischen Kriterium wird, … und eine „Ethisierung des Christentums“ eintritt.“ (S. 170) Außerdem wächst für Maier „den subjektiven Faktoren eine beherrschende Rolle zu.“ (S. 9) Und: „Mit dem Vernunftglauben ist der Individualismus einer der stärksten Motive der historischen Kritik.“ (S. 240) „Wir entdecken, dass die Trennung von Schrift und Offenbarung … einen ganz andersartigen Raum schaffen kann: dem Empfinden … Wie will die gemäßigte Kritik, gefangen im Zwei-Instanzen- und im Widersprüchlichkeits-Denken, den Umschlag in eine solche Erfahrungstheologie verhindern?“ (S. 331)
Ist „gemäßigte Kritik“ die Lösung?
Mit „gemäßigter Kritik“ meint Maier den theologischen Versuch, die historisch-kritische Herangehensweise mit konservativen theologischen Positionen zu verbinden. Diesem Versuch erteilt Maier eine Absage, denn: „Sie begnügt sich als Vermittlungstheologie … wo ein grundsätzlicher Neuanfang erforderlich wäre. Statt die Schrift als inspiriert zu betrachten lässt sie nur eine Inspiration der biblischen Schriftsteller gelten. Sie bleibt darin der Aufklärung verhaftet, dass sie neben die Schrift eine zweite Instanz stellen muss, vor der sich der Ausleger zu verantworten hat. Sie kann infolgedessen die reformatorische Sicht von der Bibel als der einzigen norma normans nicht durchhalten. Sie fordert die Sachkritik an der Bibel. Ohne Sachkritik gibt es für sie keine Theologie als Wissenschaft. Die Einheit der Schrift wird von ihr preisgegeben. Schrift und Offenbarung bleiben bei ihr verschiedene, sich nur teilweise deckende Größen. Deshalb folgt sie dem Trend, das Eigentliche jenseits der Schrift zu suchen. Indem sie Schrift und Offenbarung voneinander trennt und nur bestimmte Aussagedimensionen als Gottes Wort anerkennt, fördert sie den Hang zur Erfahrungstheologie.“ (S. 331)
Vertrauen und Offenheit statt „wissenschaftlicher Zweifel“
Grundsätzlich notwendig ist für Maier eine klare Absage an das Prinzip des „wissenschaftlichen Zweifels“, denn: „Eine Begegnung mit der Offenbarung, die Skepsis und Zweifel zum Prinzip macht, bedeutet ein brüskes Nein zu ihrer Vertrauensbemühung. Man kann den Ausleger psychologisch und existenziell in keine schroffere Gegenposition versetzen, als indem man ihm den Zweifel vorschreibt.“ (S. 247). Stattdessen fordert er einen theologischen Wissenschaftlichkeitsbegriff, der dem Forschungsgegenstand gerecht wird: „Ein prinzipieller Zweifel ist … das unangemessenste Verfahren für den Umgang mit der Bibel.“ (S. 14) „Jede Wissenschaft richtet sich nach ihrem Gegenstand. Biblische Wissenschaft müsste sich demnach aus dem Reden Gottes aufbauen. Sie müsste bereit sein, sich ihre Erkenntnisse und Positionen aus der Offenbarung selbst geben zu lassen.“ (S. 268) „Unter dieser Voraussetzung ist die Theologie samt ihrer Hermeneutik eine Wissenschaft. Allerdings eine Wissenschaft sui generis (eigener Art), die sich von allen anderen durch ihre Offenbarungsgebundenheit und ihren Glaubensbezug unterscheidet.“ (S. 34)
Entsprechend charakterisiert Maier die angemessene Haltung des Auslegers gegenüber dem biblischen Text wie folgt: „Nirgends ist uns die Unfehlbarkeit des Verständnisses versprochen (vgl. 1 Kor 13,9). Doch wird den Ausleger … ein Urvertrauen zur Bibel als der schriftgewordenen Offenbarung begleiten. … Dieses Urvertrauen schlägt sich nieder in dem Vertrauensvorschuss, der der Bibel gewährt wird.“ (S. 49) „Seine Grundhaltung ist das erwartungsvolle Gebet und die demütige Offenheit.“ (S. 339)
Ich kann meiner Kirche mit ihren theologischen Fakultäten nur von Herzen wünschen, dass sie auf Prof. Maier hört. Längst ist sein Ruf zur Umkehr auch in den Freikirchen und in der evangelikalen Bewegung insgesamt dringend notwendig, denn die Trennung zwischen Schrift und Offenbarung ist auch dort weit verbreitet.
Das Buch ist 1990 im SCM R.Brockhaus-Verlag erschienen (zuletzt 2017 in der 13. Auflage) und kann hier bestellt werden.